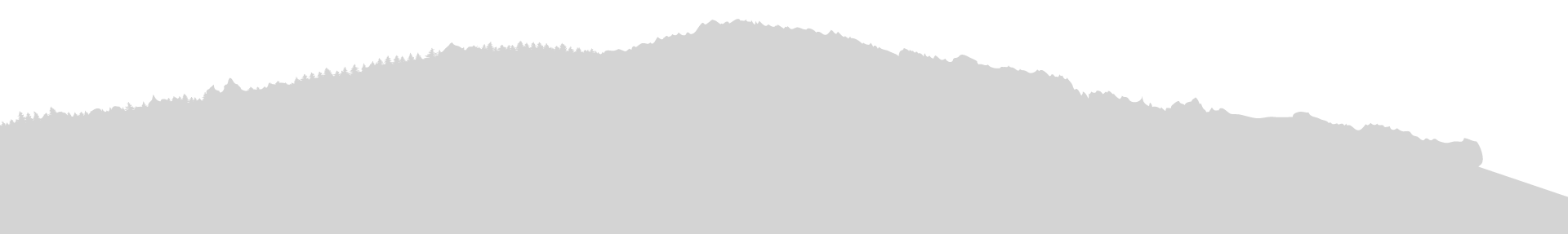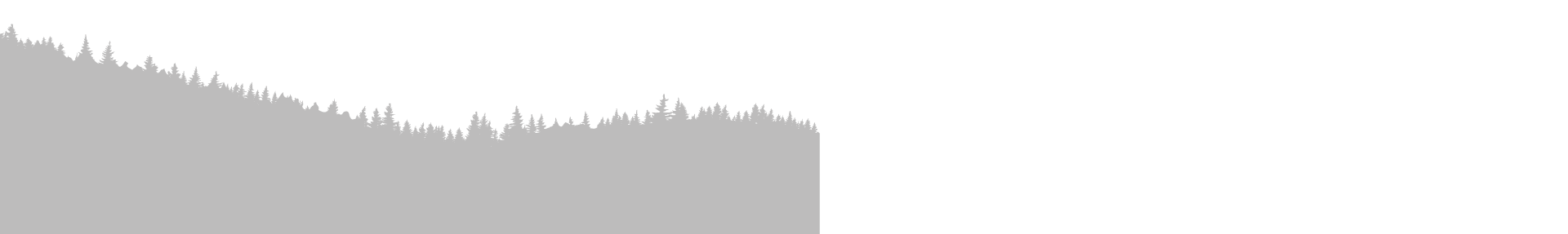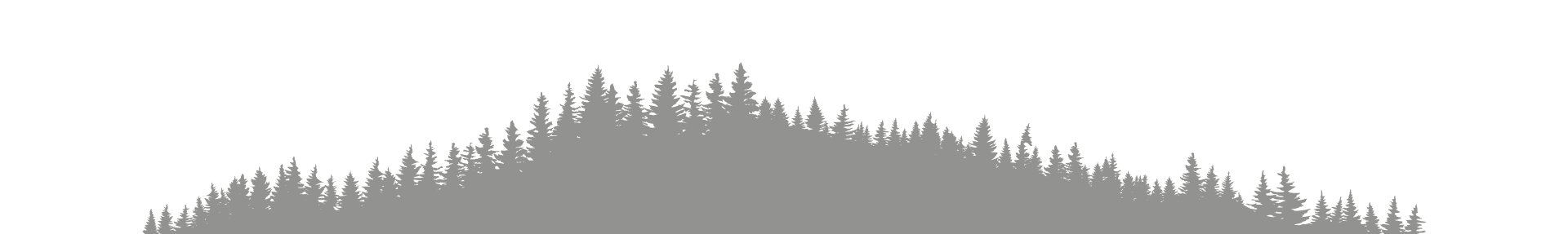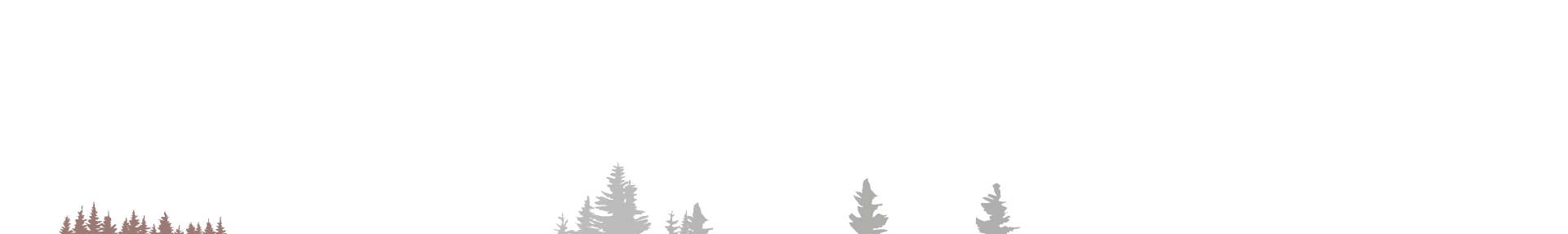Der Wald leidet – das zeigt ein einziger Blick auf die Bergkämme unserer fichtenreichen Gegend. Seit einigen Jahren vollzieht sich, dem Klimawandel geschuldet, ein radikaler Wandel in den Wäldern auch unseres Stadtgebietes. Wie können, wie sollten wir auf die aktuellen Herausforderungen reagieren – wo sollten wir regulieren, wo können wir nur zusehen? Vier Fragen an Markus Gumpricht, Förster und Revierleiter des Forstbetriebsbezirks Meinerzhagen.
Herr Gumpricht, beginnen wir mit dem Wahrwald: Dort wurden Bäume gefällt und die Waldkante deutlich zurückgesetzt – warum ist das passiert und wie geht es weiter?
Der Zustand des Wahrwalds ist beispielhaft für den unserer Wälder insgesamt: Den Fichten und auch vielen Lärchen ist es zu trocken geworden und mit dem Absterben der Bäume steigt das Verletzungsrisiko für Spaziergänger. Wir haben deshalb die betroffenen Bäume aus dem Wald genommen. Hinzu kommt beim Wahrwald seine Lage zwischen bebauten Bereichen. Das erschwert die forstwirtschaftliche Nutzung, denn wir haben kaum Möglichkeiten, das Holz abzutransportieren. Deshalb habe ich vorgeschlagen, den gesamten Wald aus der aktiven Holzwirtschaft herauszunehmen.
Außerdem haben wir Vorbereitungen für den neuen Anbau an der Grundschule getroffen und einen Sicherheitsabstand von 30 Metern, also einer Baumlänge, zwischen dem Waldrand und der Bebauungslinie geschaffen. Ich weiß, dass sich das Bild des Wahrwaldes sehr verändert hat, aber wir wollen den Konflikt zwischen Wald und sehr naher Bebauung entschärfen, für Verkehrssicherung sorgen und die kranken oder toten Nadelhölzer entfernen. Nun möchten wir ihn sich selbst überlassen; er kann sich regenerieren und entwickeln. Das bietet übrigens auch neue Lebensräume beispielsweise für Heckenbrüter.
Wie stellt sich die Situation in den heimischen Wäldern insgesamt dar?
Auf Meinerzhagener Gebiet ist knapp die Hälfte des Fichtenbestandes – auch junge Fichten – erkrankt, vom Borkenkäfer befallen oder bereits abgestorben. Wir hoffen auf einen kühlen und niederschlagsreichen Sommer, sonst fällt die Bilanz zum Jahresende noch verheerender aus. Die Gründe dafür liegen ganz klar im Klimawandel. Die Jahresmitteltemperatur steigt um bis zu zwei Grad an, der Niederschlag im Sommer ist um etwa die Hälfte reduziert und wenn es regnet, dann oft schubweise, so dass die Böden das Wasser kaum aufnehmen können. Steinreiche Böden und eine geringe Wurzeltiefe tun ihr Übriges. Die Fichte aber braucht viel Wasser, und so wird sie anfällig. Auch die Buche leidet bereits enorm unter der Trockenheit. Weil sie nicht geballt vorkommt, fällt das optisch noch nicht so auf. Aber die Veränderung vollzieht sich spürbar: Auch im Sauerland werden wir dauerhaft mit mehr Trockenheit und Wärme umgehen müssen, und das wird die Vegetation sichtbar beeinflussen.
Wie reagieren Sie auf diesen Wandel?
Zunächst einmal: Wir werden uns nicht von der Fichte verabschieden müssen. Wir werden sie von den sonnenbestrahlten Bereichen auf die besser wasserversorgten Standorte im Norden, Nordwesten und Nordosten zurückdrängen. Zurzeit sind wir mit Hochdruck dabei, das Borkenkäferholz aus den Wäldern zu holen und einer Vermarktung zuzuführen, was allerdings angesichts der schlechten Qualität nicht einfach ist. Dem Gedanken, das Totholz stehen zu lassen, stehen die Gefahren für Wanderer und auch die Arbeiter gegenüber. Danach folgt die Aufforstung. Dabei werden wir auf neue Baumarten wie die heimische Traubeneiche, die amerikanische Roteiche, die Rotbuche und die Winterlinde zurückgreifen. An Nadelhölzern können wir mit der Kiefer, der Weißtanne, der Douglasie und der japanischen Lärche arbeiten. Die Natur weiß auch, sich selbst zu helfen. Birken werden sich als Vorreiter auf den gerodeten Flächen ansiedeln und den Neuanpflanzungen als Schattenspender dienen. Eins ist aber klar: Wir können die Schraube neuer Baumarten nicht unendlich drehen. Tatsächlich müssen wir als Gesellschaft umdenken und den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren.
Was bedeutet das für uns?
Die Folgen dieser Entwicklung sind sowohl in ökologischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht dramatisch. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir das Holz auch als Rohstoff benötigen, und zurzeit können wir nur ein Viertel unseres Bedarfs durch eigene Bestände abdecken. Das hat zur Konsequenz, dass die Holznutzung auf Wälder in anderen Ländern verlagert wird. Dadurch, dass wir die Fichte abräumen und damit viel Substanz verloren geht, haben wir für lange Zeit eine Lücke in der Versorgung. Wir müssen alles daran setzen, den Klimawandel aufzuhalten, unsere Wälder zu vitalisieren und auch unseren Holzbedarf weiter zum größeren Teil aus unseren Beständen abzudecken.
Markus Gumpricht leitet als Forstbeamter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW seit Februar 2020 das Forstbetriebsrevier Meinerzhagen und betreut die privaten und städtischen Wälder im Stadtgebiet. Zuvor war er 17 Jahre Revierleiter im Ebbegebirge und elf Jahre in den Bereichen Forstliche Förderungen und Qualitätsmanagement im Regionalforstamt tätig.
( )